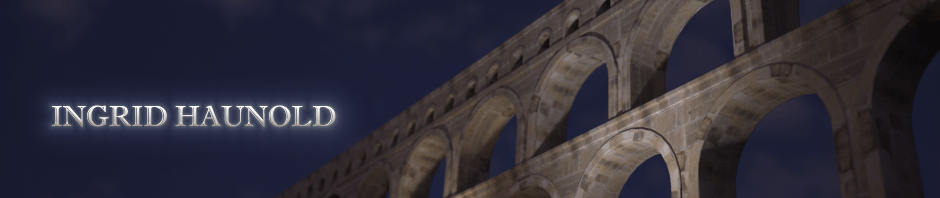Viele Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer sind mit “ihren” Hausverwaltungen unzufrieden, wie ich bereits in einem früheren Artikel dargelegt habe. In diesem dritten Teil der Artikelserie über die systemischen Ursachen für die schlechte Verwaltung von Wohnungseigentum möchte ich ganz grundsätzlich auf das Thema Vertragsbeziehungen eingehen.
Ein Forschungszweig der Volkswirtschaftslehre, die Neue Institutionenökonomik, beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen Vertragspartnern. Die Prinzipal-Agent-Theorie ist ein wichtiges theoretisches Modell, das erklärt, wie Beziehungen zwischen Vertragspartnern funktionieren.
Der Prinzipal ist der Auftraggeber. In Vertragsbeziehungen zwischen Eigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen ist der Prinzipal die Eigentümergemeinschaft. Die Hausverwaltung ist in dieser Beziehung der Agent. Wenn Verträge zwischen Prinzipal und Agent abgeschlossen werden, herrscht zwischen den Vertragspartnern eine Informationsasymmetrie. Sowohl der Prinzipal als auch der Agent können einen Wissensvorsprung haben. Beide Vertragsparteien verfolgen unterschiedliche Ziele.
Der Prinzipal (Eigentümergemeinschaft) engagiert einen Agenten (Hausverwaltung), damit der Agent bestimmte Aufgaben für den Prinzipal wahrnimmt. Da aber die Vertragsparteien unterschiedliche Ziele verfolgen, sind Konflikte unvermeidbar.
In Bezug auf die Wissensasymmetrie kommt es auch auf den Zeitpunkt der Vertragsbeziehungen an: Der Prinzipal muss vor einem Vertragsabschluß (“ex ante”) entscheiden, welcher Agent am besten geeignet sein könnte, die Aufgaben des Prinzipals wahrzunehmen. Aber der Prinzipal hat ja nur sehr eingeschränkt Einsicht in die Ressourcen und Qualifikationen eines Agenten und kann eigentlich gar nicht richtig beurteilen, ob ein Agent ausreichend qualifiziert ist, um die Aufgaben des Prinzipals wahrzunehmen.
Im Rahmen der Prinzipal-Agent-Theorie spricht man in diesem Zusammenhang von “verborgenen Eigenschaften”. Nach Vertragsabschluss (“ex post”) sind dann vor allem “verborgenes Handeln” und “verborgene Informationen” in der Beziehung zwischen Prinzipal und Agent ein Problem.
Der Begriff “verborgenes Handeln” bezieht sich darauf, dass der Prinzipal oft nur das Ergebnis des Handelns des Agenten sieht, aber keinen Einblick in den Ressourceneinsatz des Agenten hat, also nicht sieht, welche bzw. wie viele Ressourcen der Agent einsetzt, um ein bestimmtes Ergebnis für den Prinzipal zu erzielen. Der Begriff “verborgene Informationen” bezieht sich darauf, dass der Prinzipal aufgrund mangelnden Fachwissens die Qualität der geleisteten Arbeit des Agenten oft gar nicht beurteilen kann.
“Der Prinzipal beauftragt den Agenten in der Erwartung, dass dieser seine Aufgabe im Sinne des Prinzipals erledigt. Er kann jedoch das Engagement und/oder die Qualitäten seines Agenten nur mit Einschränkungen beurteilen und sieht – wenn überhaupt – nur das Ergebnis von dessen Bemühungen. Demgegenüber hat der Agent einen Informationsvorsprung, da er die eigene Qualität besser kennt und das eigene Verhalten selbst festlegen und entsprechend gut beurteilen kann. Er wird diese Informationsasymmetrie zu Ungunsten des Prinzipals ausnutzen, wenn dies seinen eigenen Zwecken dienlich ist.” (Quelle: Wikipedia).
Ich würde die unterschiedlichen Ziele von Prinzipal und Agent so zusammenfassen: Der Prinzipal will, dass der Agent mit möglichst großem Einsatz von Ressourcen möglichst viel Arbeit für den Prinzipal erledigt. Der Agent will genau das Gegenteil: Er möchte mit möglichst wenig Ressourcen möglichst wenig Arbeit verrichten. Je geringer der Ressourceneinsatz des Agenten, desto höher der Profit des Agenten.
Übertragen auf die Beziehung zwischen Eigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen kann man das so formulieren: Je mehr Liegenschaften ein einzelner Mitarbeiter einer Hausverwaltung betreuen kann, desto höher der Profit für das Hausverwaltungs-Unternehmen. Je weniger Arbeitsaufwand für eine einzige Liegenschaft notwendig ist, desto mehr Liegenschaften können von einem einzigen Mitarbeiter betreut werden.
Jeder Kundenkontakt und jede Abstimmung, die organisiert werden muß, bedeutet zusätzliche Arbeit für einen Mitarbeiter einer Hausverwaltung.
Es ist also logisch, dass es im Sinne einer Hausverwaltung ist, Kundenkontakte zu minimieren. Den Eigentümergemeinschaften muß das bewußt sein, dass die Minimierung von Kundenkontakten das Profitpotential von Hausverwaltungen erhöht – und sie müssen gegensteuern, indem sie detaillierte Verträge aushandeln, in denen die Hausverwaltungen zu einem bestimmten Handeln innerhalb bestimmter Fristen verpflichtet werden.
Eigentümergemeinschaften haben keinen Einblick in die internen Arbeitsprozesse von Hausverwaltungen. Eigentümergemeinschaften müssen sich während der Vertragsverhandlungen im Prinzip auf das verlassen, was Hausverwaltungen behaupten, wenn sie sich um einen neuen Vertrag mit einer Eigentümergemeinschaft bewerben. Aber wenn das, was behauptet bzw. versprochen wird, nicht vertraglich festgehalten wird, sind solche Versprechungen praktisch wertlos. Denn wenn es aufgrund unterschiedlicher Erwartungen eventuell irgendwann zu einem Gerichtsverfahren kommt, zählen nur Beweise. Was in einem Vertrag nicht schriftlich festgehalten wird, ist allenfalls eine Behauptung, aber kein Beweis.
Deshalb sind detaillierte Verträge zwischen Eigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen auch so wichtig. In der Realität sind die meisten Verträge, die zwischen Eigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen abgeschlossen werden, aber äußerst oberflächlich. Es werden kaum jemals Details geregelt, welche die Hausverwaltungen explizit zu einem bestimmten Handeln verpflichten.
In einem Vertrag könnte z. B. festgelegt werden, dass eine Hausverwaltung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Meldung eines Gebrechens (notwendige Reparatur, Erhaltungsarbeiten) handeln muss und zumindest damit beginnen muß, innerhalb dieses Zeitrahmens Kostenvoranschläge einzuholen. Man könnte vertraglich festlegen, dass ab einer bestimmten Reparatursumme (laut Kostenvoranschlägen) danach zwingend eine Abstimmung unter den Eigentümern organisiert werden muß, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Man könnte vertraglich festlegen, dass alle Kostenvoranschläge der Eigentümergemeinschaft vorgelegt werden müssen. Man könnte auch festlegen, dass Erhaltungsarbeiten innerhalb einer bestimmten Frist zwingend durchgeführt werden müssen.
Ich fordere z. B. seit dem Jahr 2013 bei der mittlerweile schon zweiten Hausverwaltung Erhaltungsarbeiten an den Terrazzoböden im Eingangsbereich meines Stiegenhauses ein und erst jetzt, im September 2025, wurden diese Erhaltungsarbeiten beauftragt. In diesen 12 Jahren ist der Schaden an den Böden immer größer geworden. Vielleicht wäre ja eine Reparatur der Original-Terrazzoböden aus den 1960er Jahren im Jahr 2013 leicht möglich gewesen, und billiger noch dazu.
Da der Schaden an den Böden 12 Jahre später mittlerweile aber schon sehr groß ist, müssen die Terrazzoböden jetzt komplett erneuert werden. Die Hausverwaltung ist nicht verpflichtet eine Abstimmung darüber zu organisieren, wie die Terrazzoböden erneuert werden sollen — da gibt es unterschiedliche bautechnische Möglichkeiten, wie ich jetzt gelernt habe. Ich ärgere mich natürlich sehr, dass die Hausverwaltung diese wichtige Entscheidung selbst getroffen hat und bin mit der getroffenen Entscheidung nicht glücklich, aber diese Vorgehensweise der Hausverwaltung ist leider völlig legal. Da unser Vertrag nur sehr oberflächlich formuliert ist, und die Eigentümergemeinschaft der Hausverwaltung fast keine Vorgaben in Bezug auf ihr Handeln macht, kann die Hausverwaltung viele wichtige Entscheidungen ganz alleine treffen.
Fazit: Detaillierte Verträge sind von größter Wichtigkeit und den Hausverwaltungen sollten explizite Vorgaben in Bezug auf ihr Handeln innerhalb bestimmter Fristen gemacht werden.